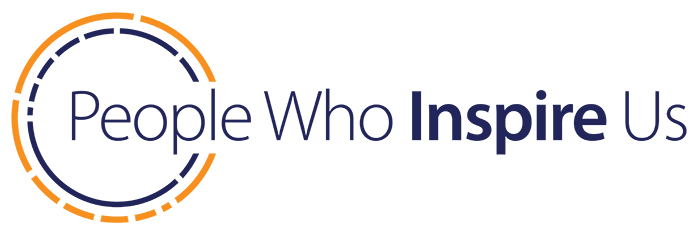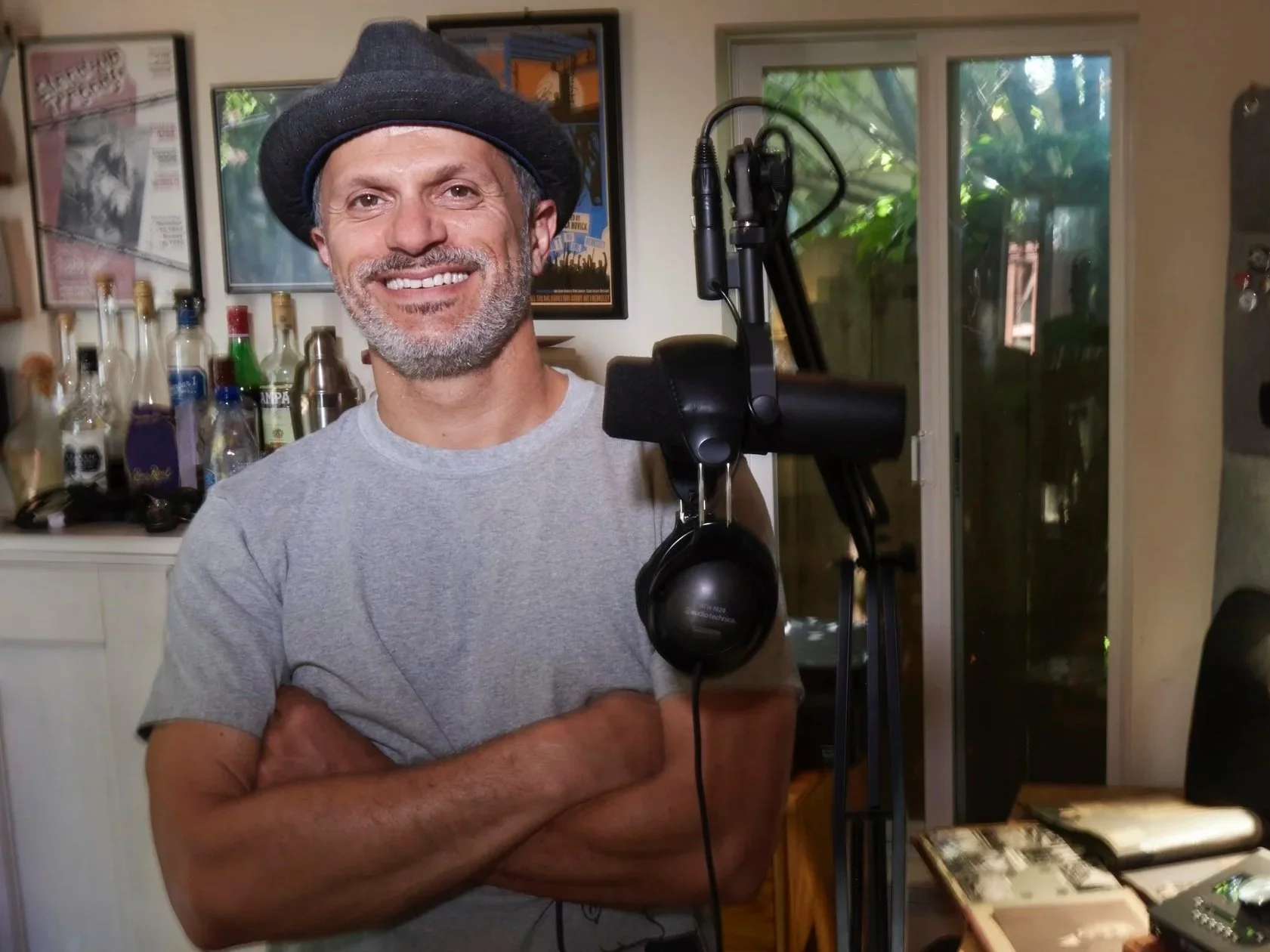Dan Wolf
Dan Wolf, bereits bekannt als kreativer und provokanter Dramatiker, Regisseur und Schauspieler, arbeitet gerade an einem Buch. Es könnte ein Wegweiser für die Zukunft wirklich nachhaltiger Erinnerungsarbeit sein.
Wolf ist ein Teilnehmer unseres 2025 Berlin Fellowship, einem einjährigen intensiven Bildungsprogramm. Zusammen mit dem verstorbenen Regisseur Jens Huckeriede entwickelte er „Sound in the Silence“, ein einzigartiges und beeindruckendes Erinnerungsprojekt, das auf Performance basiert und auf mehreren Ebenen arbeitet. Das grundlegende Konzept ist, Menschen, in der Regel Schüler*innen, zusammenzubringen, die sich für Kunstformen wie Theater, Musik, Tanz, Rap und Schreiben interessieren.
Die Gruppe besucht eine historische Gedenkstätte, an der sich Traumata und Unterdrückung ereignet haben. Die Teilnehmer*innen verbringen drei intensive Tage damit, sich mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen. Anschließend entwickeln sie mit Hilfe der Gruppenleitung individuelle künstlerische Ausdrucksformen auf Grundlage des Gelernten. Schließlich kommt die Gruppe zusammen und verbringt drei weitere Tage damit, diese individuellen künstlerischen Ausdrucksformen zu einer gemeinsamen Abschlussperformance zu verarbeiten, die dann häufig an der Gedenkstätte selbst aufgeführt wird.
Eine besondere Veranstaltung
Nehmen Sie an einem virtuellen Gespräch mit Dan Wolf teil. Mittwoch, 12. November, um 19:00 Uhr (13:00 Uhr ET). (Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.)
„Die Aufführung findet in der Regel an verschiedenen Orten statt“, sagt Wolf. „Man kann sich das als eine mobile Installation, eine Art geführte Tour oder einen performativen Spaziergang vorstellen. ... Wir möchten, dass es für alle Beteiligten zu einer fast grenzüberschreitenden Erfahrung wird.“
Bei einer Aufführung in der Mahn- und Gedenkstätte des Konzentrationslagers Ravensbrück wurden die Zuschauer*innen beispielsweise gebeten, ihre Augen zu schließen. Dann wurden sie von Mitwirkenden angesprochen, die sie aus dem Außenbereich des Lagers durch das von den ehemals von Lagerwachen des KZ benutzte Tor begleiteten. Als sie ihre Augen öffneten, hatte sich ihre Perspektive völlig verändert: Von außerhalb des Lagers ins Innere.
„Wir wollen das Publikum dann nicht einfach so gehen lassen“, erzählt Wolf. „Wir wollen provozieren. Wir wollen zum Nachdenken anregen. Wir wollen, dass ihr diese Gedenkstätten mit anderen Augen seht. Wir wollen, dass ihr es in eurem Kopf, eurem Herzen und eurem Bauch versteht, wirklich mit dem ganzen Körper.“
Proben für die „Sound in the Silence“ Aufführung
Eine Aufführung von „Sound in the Silence“, bei der die Umgebung als Teil der Performance genutzt wird.
Da es immer weniger Überlebende des Holocaust gibt, die ihre Geschichten erzählen können, stellt sich die Frage, wie man eine lebendige Erinnerung schaffen kann, die auch emotional berührt. Wolf setzt dabei auf die Kraft der (Darstellenden) Künste.
Seine Perspektive beginnt mit seiner eigenen Familiengeschichte. Wolf hat polnische und deutsch-jüdische Wurzeln. Sein Urgroßvater und dessen zwei Brüder bildeten Anfang des 20. Jahrhunderts ein sehr beliebtes Komikerduo in Deutschland. Da sie Juden waren, wurden sie 1933 von den Nazis gezwungen, ihre Auftritte einzustellen; einer der drei Brüder wurde später im Lager Theresienstadt ermordet.
Als junger Mensch, der in San Rafael, Kalifornien, aufwuchs, hatte Wolf ein starkes Interesse am Theater und besuchte eine High School mit einem eigenen Theaterprogramm. Die Lehrpersonen dienten als Berater*innen, aber von den Schüler*innen wurde erwartet, dass sie die gesamte Arbeit selbst übernehmen, von der Entwicklung der Theaterstücke bis zum Verkauf der Eintrittskarten.
„Viele der Lektionen, die ich dort gelernt habe, bilden die Grundlage für meine Arbeit heute“, erzählt er. „Ich habe gelernt, meine eigenen Stücke zu schreiben. Ich habe gelernt, wie man Regie führt. Ich habe gelernt, wie man unterrichtet. Wir mussten Geld auftreiben. Wir mussten lernen, wie man die Lichttechnik bedient.“
Er entwickelte auch eine Vorliebe für Hip-Hop-Musik und begann sich für Rap zu interessieren, inspiriert von den Beastie Boys, einer Band aus New York City, deren Mitglieder jüdisch waren. „Ich sage immer, die Beastie Boys haben [Hip-Hop] in meine Nachbarschaft gebracht, weil sie so aussehen wie ich, und dann habe ich herausgefunden, dass sie Juden sind, und dachte: Oh, okay.“
Die Wolf-Brüder waren bis 1933 eine beliebte Comedy-Gruppe in Hamburg.
Wolf gründete mit einigen Freund*innen aus einem Theaterkurs der Uni eine Rap-Gruppe. Die Band startete durch, als ein Lehrer sie dazu ermutigte, ein Theaterstück mit Rap zu schreiben. Das Stück, das sie schrieben, „Beatbox: A Raparetta“, war eine Parabel über zwei Stiefbrüder, die als Hip-Hop-Straßenkünstler auftreten.
„Das Coole daran war, dass der gesamte Soundtrack live erstellt wurde. Beatboxing, Vocal Drum Percussion und der DJ bildeten also im Grunde genommen das Orchester. Wir haben damit experimentiert, wie wir die Form und Funktion eines Theatermusicals mit Hip-Hop-Ästhetik verbinden können“, so Wolf. Die Gruppe mit dem Namen "Felonious" begann als Vorgruppe für große Acts in der San Francisco Bay Area aufzutreten. Sie wurden zu Auftritten in New York und auch in Deutschland, in Hamburg und Berlin eingeladen. Die Operette wurde später von einer gemeinnützigen Organisation veröffentlicht und 2024 in Houston zum ersten Mal von einem anderen Ensemble aufgeführt.
Vor „Sound in the Silence“ entwickelte Wolf in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Filmemacher Jens Huckeriede ein Theaterstück mit dem Titel „Stateless“. Die beiden lernten sich kennen, als Huckeriede einen Film über die Wolf-Brüder drehte.
„‚Stateless‘ war ein Theaterstück, das meine Familiengeschichte wirklich widerspiegelte. Es stellte Parallelen zwischen den Erfahrungen jüdischer Menschen in Deutschland und denen afroamerikanischer Menschen in den USA her. In dem Stück besuchen wir ein Konzentrationslager, was nicht nur Erinnerungen an die Geschichte der Konzentrationslager weckt, sondern auch an den Komplex der Gefängnisindustrie. Bei unseren Recherchen stellten wir fest, dass die von Hitler erlassenen Nürnberger Gesetze den Jim-Crow-Gesetzen nachempfunden waren, also haben wir einen Teil des Stücks den Jim-Crow-Gesetzen und den Nürnberger Gesetzen gewidmet und sie so wirklich in Beziehung zueinander gesetzt.“
Die Handlung des Stücks dreht sich um zwei Freunde, eine deutsch-jüdische und eine afroamerikanische Person, die gemeinsam eine Reise antreten. Wolfs Figur findet einen Brief seines Großvaters, und die beiden begeben sich daraufhin auf die Suche nach seinen Wurzeln. Die Beziehung und die Hintergründe der beiden Freunde greifen auf faszinierende Weise ineinander und driften dabei jedoch auch auseinander.
Das Stück wurde 2006 in San Francisco uraufgeführt. Sie holten es nach Hamburg und Berlin und fuhren dann nach Ravensbrück, um dort Hip-Hop-Theaterworkshops mit deutschen Jugendlichen zu halten. „Hier begannen wir, über „Sound in the Silence“ nachzudenken“, sagt Wolf. „Hier verschmolzen unsere Kunstformen wirklich miteinander.“
Ein Wendepunkt war die Führung durch Ravensbrück, an der die Darsteller*innen teilnahmen. Die Kraft und Emotionalität dieses Ortes überwältigten Wolf und die anderen: „Ich war wie gelähmt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wie ich weitermachen sollte“, sagt er.
Die anderen Darsteller begannen, durch ihre Kunst zu reagieren. Einer der Darsteller fing an zu beatboxen, ein anderer begann mit Freestyle-Rapping, mit sehr direkten Texten über das, was sie gesehen hatten und wie es in der heutigen Welt noch nachhallt. Die Tänzer begannen zu tanzen.
„Das regte wirklich zum Nachdenken darüber an, wie Kunst tatsächlich ein Gesprächsaufhänger sein kann, wie wir uns selbst aus dem Weg gehen können, wie wir diese Art von Bewusstsein ausschalten und uns in das Unbewusste begeben können, um mit einem Großteil dieses Traumas umzugehen, denn es ist wirklich ein Trauma.“
Diese Erfahrung brachte Wolf und Huckeriede dazu, über „Sound in the Silence“ nachzudenken – eine Performance, in der nicht Profis, sondern junge Menschen auftreten, die an einem Ort des Traumas und der Unterdrückung zusammenkommen, etwas über diesen Ort lernen und das Gelernte und ihre Gefühle dazu in eine einzigartige Performance einfließen lassen.
„In ‚Sound in the Silence‘ bin ich nicht der Protagonist. Ich habe mich selbst herausgenommen und in gewisser Weise haben wir die Teilnehmenden in die Position des Protagonisten versetzt. Und anstelle meiner Familiengeschichte steht die Geschichte des Ortes im Zentrum“, so Wolf.
„Man muss über fundierte dramaturgische Kenntnisse über den Ort verfügen, um wirklich zu verstehen, zu fühlen und sich einen Eindruck davon machen zu können, was hier passiert ist. Es reicht nicht aus, einfach hier aufzutauchen und zu sagen: Oh, hier ist etwas Schlimmes passiert, jetzt werde ich darüber rappen. Man muss wirklich ganzheitlich erfahren, was passiert ist“, sagt er.
„Wir wollen euch nicht vorschreiben, was ihr fühlen oder denken sollt. Wir wollen Kunstformen nutzen, die sich mit den Leerstellen und Zwischenräumen auseinandersetzen.“
Viele Darsteller*innen haben Wolf erzählt, dass die Teilnahme an „Sound in the Silence“ einen bleibenden Eindruck auf sie hinterlassen hat.
„Ich habe beobachtet, wie sich diese jungen Menschen verändert haben, und sie haben mir [später] erzählt, wie sehr dies ihr Leben beeinflusst hat“, sagt Wolf. „Das ist ein unbeabsichtigter, aber schöner Aspekt und ein tolles Resultat des Projekts.“
Das Buch, an dem Wolf gerade arbeitet, befasst sich eingehend mit den Methoden, die zur Erarbeitung einer „Sound in the Silence“ Performance verwendet werden. In mehr als einem Dutzend Jahren Arbeit an dem Projekt mit jungen Menschen und Erwachsenen, mit erfahrenen Darsteller*innen und Neulingen, mit Menschen, die bereits eine tiefe Verbindung zur Geschichte haben, und solchen, die wenig oder gar nichts darüber wissen, hat er verstanden, dass es dazu eingesetzt werden kann, sich mit Unterdrückung und Erinnerung in jeder Gemeinschaft auseinanderzusetzen und nicht darauf beschränkt ist, die Geschichte des Jüdischen Volkes während des Holocaust zu erzählen. Und er möchte den Menschen helfen, zu verstehen, wie sie ihre eigenen Aufführungen entwickeln können. Er hat dieses Modell auch als schulisches Projekt mit 150 Schüler*innen einer Highschool in Oakland, Kalifornien, getestet. Ericka Huggins, einstige Anführerin der Black Panther Party, hielt im Rahmen dieses Projekts einen Vortrag vor den Schüler*innen.
Wolf hat zwar die führende Rolle bei der Entwicklung des Modells „Sound in the Silence“ gespielt, doch dessen Vielfältigkeit und Flexibilität haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt: „Es wurde stark von den Hunderten von Menschen beeinflusst, die damit in Berührung gekommen sind“, sagt er. „Das ist das Beste daran: Es ist ein eigener lebendiger, atmender Organismus.“
Erfahren Sie mehr über Dan Wolf und seine Projekte unter dan-wolf.com.
Hier sehen Sie ein Video über die Entstehung einer Sound in the Silence-Produktion.